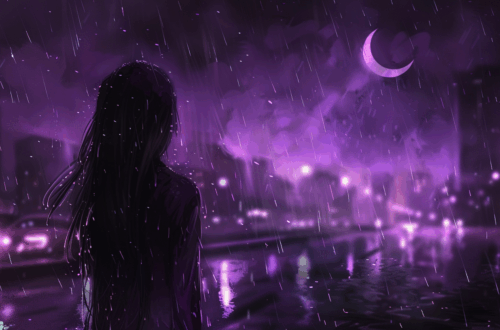Schattenherz – Kapitel 1
Shit. Ich hatte wieder verpennt.
Als wäre mein Leben nicht sowieso schon eine einzige Gratwanderung über einem Abgrund, der jeden Moment breiter zu werden drohte.
Ich lag da – verheddert in Laken, die eher an ein Schlachtfeld erinnerten als an irgendetwas, das mit Erholung zu tun haben könnte –, und draußen drosch der Regen gegen die Scheibe, nicht als sanftes Prasseln mit melancholischer Filmmusik, sondern als wütendes, beleidigendes Trommeln, das klang, als hätte der Himmel persönlich beschlossen, mir heute den Mittelfinger zu zeigen.
Der Wecker? Zum dritten Mal geklingelt. Natürlich.
Ein perfekter Auftakt für einen weiteren Tag in dieser trostlosen Parade aus durchgekauten Katastrophen.
Es war, als hätte das Universum sich heute besonders viel Mühe gegeben, mich nicht einfach nur zu ignorieren, sondern aktiv auseinanderzunehmen – draußen war es grau, matschig, hoffnungslos, wie der schlecht gelaunte Nachhall eines Indie-Films, in dem alle Charaktere irgendwann aufhören zu sprechen, weil sowieso nichts mehr zu sagen ist.
Die Straßenbahn? Klar, ausgefallen.
Warum auch nicht.
Ich stand also an der Haltestelle, durchnässt bis auf die Knochen, das Haar verklebt im Gesicht, sah aus wie das traurige Ergebnis einer Soap-Produktion mit Budgetkürzungen und fühlte mich auch ungefähr so.
Und ich wusste jetzt schon, wie Moreau mich anschauen würde, wenn ich wieder mal zu spät ins Büro trottete – dieser langsame, enttäuschte Seufzer mit hochgezogener Augenbraue, als würde er innerlich „Wirklich jetzt?“ murmeln.
Ich hätte im Strahl kotzen können.
Als ich endlich in der nächsten Bahn stand – tropfnass, zitternd, halb in Auflösung – war mein Spiegelbild im Fenster so erbärmlich, dass sogar mein Selbstmitleid kurz innehielt und mich fragend ansah.
Zwanzig Minuten zu spät. Schon wieder.
Typisch Eve.
Aber weißt du was? Ich war längst über den Punkt hinaus, an dem man sich noch aufregt.
Alles in mir war leergewütet, ausgebrannt – ich bewegte mich irgendwo zwischen „Reicht jetzt“ und dem zynischen Flüstern von „Scheißegal“.
Im Büro war es wie immer, und vielleicht gerade deshalb kaum zu ertragen – dieses grelle, kalte Licht, das alles bloßstellt, was du zu verbergen versuchst, die Luft voller abgestandener Gedanken und billigem Kaffeegeruch, der sich wie eine zweite Haut auf deine Kleidung legt, und dazwischen die Blicke, die Geräusche, dieses unsichtbare Summen aus Halbsätzen und bedeutungsschwangeren Pausen, das nur entstehen kann, wenn Menschen lieber lästern als leben.
Die Neonröhren flackerten über mir wie ein Warnsignal, das keiner mehr ernst nimmt, und an den Fenstern hingen nicht nur Tropfen, sondern ganze Geschichten aus Trostlosigkeit – bleigraue Schleier, durch die kein Gedanke entkommt, ohne dabei ein bisschen Farbe zu verlieren.
Und ja, natürlich hatten sie wieder angefangen zu tuscheln, kaum dass ich durch die Tür trat, diese Kolleginnen mit ihren perfekt gestellten Kaffeebechern und ihrem gepflegten Schweigen, das nur dazu dient, die Sticheleien lauter wirken zu lassen, wenn sie dann endlich ausgesprochen werden.
Ich hab sie nicht angeschaut, ich wusste auch so, was in ihren Köpfen vorging – dieses aufgesetzte Mitleid, das nach billigem Spott roch, als würde man einer Sterbenden noch schnell die Lippen nachziehen, bevor man sie zur Beerdigung schickt, und vermutlich haben sie längst intern gewettet, wann ich endgültig die Nerven verliere und mich in eine Statistik verwandle, die unter „nicht mehr tragbar“ abgeheftet wird.
Ich bin einfach durchgelaufen, mein Blick stur geradeaus, meine Schritte schneller, als sie sein müssten, nicht aus Eile, sondern aus Selbstschutz, denn manchmal ist Wegsehen die einzige Art, nicht gesehen zu werden – und an diesem Morgen war ich nicht bereit, auch nur einem einzigen Menschen mein Gesicht zu geben, schon gar nicht denen, die es sich mit falscher Fürsorge zurückholen wollen.
Moreau saß an seinem Schreibtisch, und in dieser Haltung, in der er die Hände gefaltet vor sich ruhen ließ, lag etwas, das mich an ein Tier erinnerte, das weiß, dass es bald aufstehen muss, obwohl es keinen Schritt mehr gehen will – ein alter Wolf vielleicht, mit zu vielen Erinnerungen im Nacken, die schwerer wiegen als jedes Projekt, das er je abgeschlossen hat.
Als er sich schließlich zu mir umdrehte – nicht abrupt, nicht überrascht, sondern mit dieser langsamen, fast würdevollen Bewegung, die mehr von Abschied erzählte, als es seine Worte je könnten –, wusste ich sofort, noch bevor er den Mund aufmachte, dass dieser Tag nichts mehr für mich übrig hatte außer der Erkenntnis, dass etwas endet, ob man bereit ist oder nicht.
Seine Stimme, als sie kam, war zu ruhig, zu kontrolliert, zu glatt, als hätte er sie vorher hundert Mal geprobt – nicht aus Unsicherheit, sondern aus dem schlichten Wissen heraus, dass bestimmte Sätze wie Sprengsätze funktionieren, egal wie sanft man sie zündet.
„Wir bekommen einen neuen CEO.“
Kein Hallo, kein Vorbau, keine Vorbereitung – nur diese sechs Worte, die sich anfühlten wie eine kalte Hand auf meinem Rücken, zu nah, zu plötzlich, zu ehrlich, und ich spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog, ein Impuls, der irgendwo zwischen Flucht und Angriff lag, während meine Fäuste sich ganz automatisch schlossen, als wollten sie etwas festhalten, das schon längst durch meine Finger geronnen war.
Ein neuer CEO also – wunderbar –, vermutlich so ein glänzender Business-Heiland, der morgens in Designeranzügen aufwacht und glaubt, dass Empathie eine KPI ist, die man managen kann, jemand, der Lebensläufe scannt wie fehlerhafte Tabellenkalkulationen und der seine Leute nicht führt, sondern inventarisiert.
Ich konnte ihn schon vor mir sehen, diesen Mann, diesen perfekten Fremden mit dem teuren Aftershave und dem noch teureren Selbstbewusstsein, der in einen Raum tritt und glaubt, die Atmosphäre würde sich freiwillig anpassen, sobald er nur den ersten Schritt setzt – sein Anzug faltenfrei wie seine Lebensplanung, das Lächeln trainiert, gefährlich glatt, und dieser Blick, der dich taxiert, nicht weil du ihm gefällst, sondern weil er wissen will, wie effizient du zerbrechen würdest, wenn man dich ordentlich unter Druck setzt.
Ich wollte etwas sagen, irgendetwas, das mich souverän erscheinen ließ, vielleicht klug, vielleicht wenigstens wach – aber mein Hals war plötzlich trocken, mein Kopf voller Stau, und noch bevor ich mir bewusst wurde, dass ich nichts sagen würde, war es schon zu spät, denn Moreau sah mich an, nicht wie früher, nicht mit dieser leisen Strenge, mit der er mir sonst zu verstehen gab, dass ich mich wieder mal selbst im Weg stand, sondern mit einem Ausdruck, der mich innehalten ließ, weil darin etwas lag, das älter war als jede Hierarchie: ein Abschied, der keine Worte mehr fand.
Er sagte nichts, und genau deshalb war es so laut.
Er schob mir stattdessen ein paar Blätter über den Tisch – langsam, bedächtig, mit der stillen Geste eines Mannes, der weiß, dass der Inhalt dieser Seiten mehr verändert als er je erklären könnte, und als ich das oberste Papier aufnahm, fühlte es sich schwer an, nicht wegen der Grammatur, sondern wegen der Bedeutung, die zwischen den Zeilen wie Blei ruhte.
Oben stand unser Firmenlogo – gewohnt, vertraut, harmlos – und direkt darunter, in einer Typografie, die sich selbst für zu wichtig hielt:
Theyron Barent.
Fuck.
Kaum hatte ich den Namen gelesen, war er auch schon da – nicht bloß als Wort auf Papier, sondern als etwas, das sich mit schmerzlicher Präzision in mein Gehirn bohrte, wie ein feiner, kalter Splitter, der sich unter die Haut schiebt und dort liegen bleibt, ohne dass man ihn greifen oder vergessen kann.
Er klang fremd, ja, absolut – aber auf eine verstörende Weise, die nicht mit bloßer Unbekanntheit zu erklären war, eher wie eine Erinnerung, die sich nicht fassen lässt, wie ein Schatten aus einem längst vergessenen Traum, oder vielleicht eher aus einem jener Albträume, die man nachts wegdrückt und morgens nicht mehr benennen kann, obwohl das Gefühl geblieben ist, irgendwo zwischen Unruhe und Vorahnung.
Ich starrte auf das Papier, auf die glatten Buchstaben, die sich viel zu selbstsicher in dieses verdammte Blatt eingebrannt hatten, starrte auf das Logo, das plötzlich keine Bedeutung mehr hatte, weil der Name darunter alles überlagerte –
Theyron Barent.
Zwei Worte, die mehr versprachen, als sie durften.
Ein Name, der sich anfühlte wie ein Rätsel, das nicht gelöst werden will – elegant, makellos, glatt wie Marmor, aber genau deshalb so verdächtig, so gefährlich in seiner Oberflächenruhe.
„Eve?“
Moreaus Stimme holte mich zurück in den Raum, zurück in diesen Moment, in dem nichts mehr war wie vorher, auch wenn alles noch genauso aussah.
Ich hob den Blick – langsam, mechanisch – und sah in ein Gesicht, das versuchte, zu lächeln, aber nur ein müder Abklatsch von Wärme zeigte, ein zu lang getragener Ausdruck, der die Augen längst nicht mehr erreichte.
„Nimmst du bitte die Unterlagen und bereitest alles vor? Heute ist Mittwoch. Ab Montag fängt Herr Barent an.“
Ich nickte.
Natürlich nickte ich.
Was hätte ich sonst tun sollen?
Wenn das Universum beschließt, dir den Boden unter den Füßen umzubauen, während du noch barfuß darin stehst, dann bleibt dir nur, kurz zu wanken und so zu tun, als wärst du mit dem neuen Grundriss einverstanden.
Ich nahm die Papiere – nicht vorsichtig, nicht achtlos, sondern irgendwie dazwischen, als hätte ich Angst, sie könnten anfangen zu sprechen, wenn ich sie zu fest halte.
Sie waren schwer, nicht weil sie viele Seiten umfassten, sondern weil sie mehr trugen, als sie sollten – Informationen, ja, aber auch Entscheidungen, Absichten, Richtungswechsel, unausgesprochene Botschaften, vielleicht sogar Drohungen, die zwischen den Zeilen lagen wie Sprengstoff unter Seidenpapier.
„Klar“, murmelte ich, aber meine Stimme klang wie ein Echo aus einem fremden Mund – zu leise, um souverän zu wirken, zu laut, um ein Flüstern zu sein, irgendwo in diesem luftleeren Raum, den Unsicherheit hinterlässt.
Er nickte ebenfalls, aber irgendetwas in ihm hielt inne, wie ein Atemzug, den man zu lange festhält, weil man noch nicht weiß, ob man reden oder schweigen will.
„Ach, und Eve?“
Seine Stimme war jetzt anders – weicher, beinahe zärtlich, als wolle er sich für etwas entschuldigen, das er nicht ändern kann.
Ich hob den Blick, ahnte die Worte schon, bevor er sie aussprach, und trotzdem trafen sie mich mit einer Wucht, die mir kurz den Brustkorb zusammendrückte.
„Bereitest du bitte am Freitag eine kleine Abschiedsfeier vor? Das wird mein letzter Arbeitstag.“
Und da war es.
Der Satz, den ich innerlich längst vermutet hatte, aber den ich so dringend nicht hören wollte, weil es einen Unterschied macht, ob etwas nur zwischen den Gedanken existiert oder ausgesprochen wird – laut, endgültig, unwiderruflich.
Ich hätte etwas sagen sollen, wirklich – irgendein Satz, eine Frage, ein banales „Warum“ oder wenigstens ein verlegenes Lächeln, aber alles, was in meinem Kopf war, bestand nur noch aus kaputten Worten und halb zerschossenen Gedanken, die sich nicht fassen ließen, geschweige denn aussprechen.
Also nickte ich wieder – dieses hilflose, viel zu schnelle Nicken, das aussieht, als hätte man sich in der eigenen Rolle verrannt und jetzt einfach weitermacht, weil der Text zu lang ist, um nochmal neu anzufangen.
„Ich informier die anderen“, sagte ich, aber meine Stimme klang hohl, fremd, leer – wie ein Satz, den jemand anderes in meinen Mund gelegt hatte.
Er sah mich lange an – viel zu lange – so, als wollte er sich mein Gesicht einprägen, nicht nur für heute, sondern für immer, und in seinem Blick lag diese merkwürdige Mischung aus Wehmut, Müdigkeit und einem Funken von Stolz, den er nicht zeigen wollte, aber nicht ganz verstecken konnte.
„Weißt du, ich war oft hart zu dir. Aber ich hab dich immer geschätzt, Eve.“
Ich senkte den Blick.
Nicht, weil ich schwach war – sondern weil ich genau wusste, dass ich ihm sonst etwas gezeigt hätte, das ich in diesem Moment nicht mehr kontrollieren konnte.
Ich wollte antworten, wirklich.
Ich wollte sagen, dass ich ihn auch geschätzt habe, auf meine Weise, in meiner Wut, in meinem Trotz, in all dem unausgesprochenen Respekt, der sich zwischen uns angesammelt hatte wie Staub auf alten Plänen.
Aber ich sagte nichts.
Ich starrte nur auf den Boden und hoffte, dass mein Schweigen nicht alles kaputtmachte, was zwischen uns noch stand.
„Ich weiß“, hatte ich gesagt – leise, gerade laut genug, dass es nicht unterging, aber längst nicht das, was ich eigentlich sagen wollte.
Denn was ich meinte, war mehr, war schwerer, war das unausgesprochene „Ich Sie auch“, das mir schon auf der Zunge lag, aber nie den Weg hinausfand, weil es eben manchmal diese Momente gibt, in denen einem die wirklich wichtigen Worte im Hals stecken bleiben, genau dann, wenn sie am dringendsten gebraucht würden, und man nichts weiter zustande bringt als einen halben Satz, ein Nicken, ein Blick, der hofft, dass er verstanden wird, ohne erklärt werden zu müssen.
Ich bin aus seinem Büro gegangen, nicht fluchtartig, aber auch nicht mit Haltung, sondern in diesem seltsamen Zustand zwischen Stolz und Leere, die Unterlagen fest an mich gedrückt, als könnten sie mich schützen vor etwas, das ich nicht benennen, geschweige denn greifen konnte, aber das sich trotzdem schon wie ein kalter Nebel an meine Haut legte.
Der Flur war stiller als sonst – nicht wirklich leiser, aber voller unausgesprochener Dinge, die zwischen Wänden und Türrahmen hingen wie Schatten, die zu wissen schienen, dass sich hier gerade etwas verschob, das größer war als nur ein Positionswechsel.
Ich hasse solche Aufgaben – wirklich –, diese scheinbar kleinen, aber in Wahrheit grausam großen Nachrichten, die man wie vergiftete Pralinen durch die Abteilungen trägt, mit einem Lächeln, das nicht passt, und einem Skript, das man nicht glaubt.
„Er geht.“
„Abschiedsparty.“
„Neuer Chef.“
So einfach klingen diese Worte, so sauber, so harmlos fast, wenn man sie hinschreibt – aber sie reißen jedes Mal ein Stück aus einem heraus, wenn man sie aussprechen muss, vor allem, wenn man weiß, dass sie nicht nur etwas beenden, sondern etwas anderes, Unbekanntes eröffnen, das man nicht will.
Beim ersten Schreibtisch blieb ich stehen, zwang mich, meine Schritte nicht einfach weitergehen zu lassen – Julia saß da, wie immer über ihre Tabellen gebeugt, Stirn gerunzelt, die Bluse mit einem alten Kaffeefleck gezeichnet, der ihr wahrscheinlich schon lange egal war, weil sie wusste, dass niemand sie deswegen weniger brauchen würde.
Als sie aufsah, war da etwas in ihrem Blick – nicht nur Aufmerksamkeit, sondern dieses feine, fast tierhafte Gespür, das Menschen haben, wenn etwas nicht stimmt, wenn sich die Luft verändert, bevor jemand spricht.
„Eve? Du siehst aus wie der Tod auf Latschen.“
Ich versuchte zu lächeln, aber mein Gesicht gehorchte nicht wirklich – es wurde mehr eine verzogene Grimasse, ein Ausdruck zwischen Schmerz und Pflichtgefühl.
„Fast. Moreau geht. Ab Montag haben wir einen neuen CEO.“
Sie blinzelte – nur kurz –, aber ich sah, wie etwas in ihr zuckte, wie sich ihr Gesicht zusammenzog, als hätte man ein brennendes Streichholz in Papier geworfen.
„Oh Scheiße… er war doch ewig hier. Und wer kommt nach?“
„Theyron Barent“, sagte ich, und der Name kam mir über die Lippen wie etwas Fremdes, das sich noch nicht setzen wollte, aber schon Gewicht hatte, mehr als mir lieb war.
Julia verzog das Gesicht, nicht spöttisch, nicht ängstlich – eher nachdenklich, misstrauisch, als hätte sie gerade ein Glas geöffnet, dessen Inhalt sie nicht einordnen konnte.
„Klingt… verdammt teuer.“
Ich atmete aus, ein kurzes, geräuschloses Lachen ohne Freude.
„Ja. Und als ob er es gewohnt ist, dass der Aufzug nach ihm ruft und nicht umgekehrt.“
Ich ließ sie mit der Information zurück, nicht aus Kälte, sondern weil es nichts gab, was ich ihr hätte hinzufügen können, ohne dass es pathetisch geklungen hätte – und weiter ging’s zur Personalabteilung, dieser heiligen Halle der Formulare, in der selbst Gefühle durch Aktenordner gefiltert werden, bevor sie in der Verwaltung ankommen.
Die Tür stand offen, wie immer, und Frau Lemke saß an ihrem Platz, das Telefon am Ohr, den Blick irgendwo zwischen konzentriert und genervt, aber als sich unsere Blicke trafen, wurde ihr Gesicht plötzlich ruhig – nicht neutral, sondern leer, so als hätte sie innerhalb einer Sekunde verstanden, dass dieses Gespräch gerade unwichtig geworden war.
Sie legte auf – ohne Abschied, ohne Erklärung, was bei ihr bedeutete, dass etwas wirklich nicht stimmte, denn selbst bei Feueralarm lässt sie sonst nicht locker, bevor sie den Call ordnungsgemäß beendet hat.
„Eve? Was ist passiert?“
Ich legte die Unterlagen auf ihren Tisch, vorsichtig, aber bestimmt, als handele es sich um etwas, das man nicht zu nah an sich heranlassen sollte – nicht weil es schmutzig war, sondern weil es zu viel enthielt, zu viel, das man nicht rückgängig machen konnte.
„Herr Moreau geht in Rente. Freitag ist sein letzter Tag. Ich soll Sie bitten, die Umstellung für den neuen CEO einzuleiten.“
Ich sprach die Sätze aus wie jemand, der einen Wetterbericht vorliest, obwohl draußen längst der Sturm tobt – klar, deutlich, mechanisch, aber innerlich ratterte es weiter, wie ein Uhrwerk, das noch nicht weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist.
Frau Lemke griff nach den Unterlagen, und obwohl ihre Finger sich ruhig bewegten, konnte man spüren, dass etwas in ihr bereits zu arbeiten begann – sie las den Namen, langsam, mit dieser seltsamen Konzentration, die nichts mit Neugier zu tun hatte, sondern mit dem Versuch, etwas einzusortieren, das nicht auf Anhieb einen Platz findet.
„Theyron Barent…“
Der Name lag zwischen uns wie ein kaltes Stück Metall – blank, hart, unangenehm im Ton –, und als sie ihn ausgesprochen hatte, verzog sich ihre Stirn, nicht deutlich, aber doch spürbar, als hätte sie etwas geschluckt, das zu bitter war, um einfach so hinunterzugehen.
„Natürlich. Ich kümmere mich drum. Schade um Herrn Moreau. Aber… es war wohl Zeit.“
Ich nickte. Sagte nichts.
Denn was sollte ich auch sagen, wenn ich mich durch das Büro bewegte wie ein Leichenbote im Nadelstreifen, jemand, der keine Antworten bringt, sondern nur Gewissheiten, die niemand haben will?
Zurück an meinem Schreibtisch, begegnete mir der Bildschirm mit seinem offenen Dokument und dieser ganz bestimmten Leere, die nicht einfach nur digital war, sondern eine Einladung zum innerlichen Wegdriften – ich schrieb die Rundmail, so, wie es von mir erwartet wurde: sachlich, höflich, distanziert, mit einem Ton, der vorgibt, informiert zu sein, aber nichts verrät, der Nähe simuliert und doch nur verwaltet.
Bullshit-Diplomatie vom Feinsten.
Kaum abgeschickt, stand ich wieder auf – weil ich wusste, dass das nicht reicht, weil man Nachrichten wie diese nicht nur per Klick verschickt, sondern tragen muss, durch Türen, durch Gesichter, durch Erwartungen hindurch.
Ich ging von Raum zu Raum, ein stiller Dominoeffekt, bei dem jeder Fall eine neue Reaktion auslöste – Umarmungen, Stirnrunzeln, Fragen, deren Antworten ich nur zur Hälfte geben konnte.
„Was hat er denn?“
„Ist er krank?“
„Wer ist dieser Barent?“
Ich sagte, was ich durfte, was ich wusste, ohne zu lügen, aber auch ohne zu viel zu sagen, denn manche Dinge verlieren an Würde, wenn man sie zu oft wiederholt – und wie hätte ich auch erklären sollen, dass es sich anfühlte, als würden wir gerade etwas beerdigen, das niemand laut betrauern will, weil es doch „nur ein Job“ ist, „nur ein Chef“, „nur ein Wechsel“, aber alle genau wussten, dass es mehr war –
ein Stück Kontinuität, das verschwand, ersetzt durch einen Namen, der klang, als hätte er nie etwas mit uns zu tun gehabt.
Der Freitag kam, und mit ihm eine Stimmung, die nicht klar zu greifen war – es war kein Aufbruch, kein Neuanfang, keine dieser Momente, in denen Hoffnung in der Luft liegt, sondern eher ein vorsichtiges Innehalten, als würde man einen Raum betreten, in dem jemand gerade aufgestanden ist und den Stuhl noch warm zurückgelassen hat.
Ich hing Luftschlangen auf, spannte ein kleines Banner zwischen zwei Aktenschränke – „Alles Gute, Herr Moreau“ stand darauf, in einer Schrift, die zu freundlich war für den Ton des Tages –, schnitt Kuchen, stellte Sekt kalt, deckte auf, wie man eine Bühne für einen Abschied vorbereitet, bei dem keiner den Vorhang ziehen will.
Julia half mir, still, routiniert, und während wir die Gläser ordneten, sah sie mich mit einem Blick an, der mehr sagte als alles, was wir hätten formulieren können.
„Glaubst du, er kommt irgendwann mal wieder? So als Gast oder so?“
Ich schüttelte den Kopf, nicht hart, nicht bestimmt, aber ehrlich.
„Vielleicht. Aber irgendwie fühlt es sich an, als wäre das hier ein Abschied für immer.“
Die Kolleginnen und Kollegen kamen, langsam, zögerlich, einer nach dem anderen, als wüssten sie nicht genau, wie man sich benimmt bei einer Feier, die sich wie ein stiller Beerdigungsempfang anfühlt – manche lachten, leise, gezwungen, andere warfen verstohlene Blicke zu Moreau, der mit einem Glas in der Hand zwischen den Tischen stand, als würde er noch ein letztes Mal durch sein Revier gehen, nicht um Besitz zu markieren, sondern um loszulassen.
Dann kamen die Reden.
Und natürlich – wie hätte es auch anders sein sollen – blieb es an mir hängen, die ersten Worte zu sagen.
Weil ich immer die bin, die sowas „gut kann“.
Weil man denkt, ich hätte eine Stimme für solche Anlässe, obwohl ich innerlich längst an dem Punkt war, an dem man sich selbst kaum noch zuhört.
Weil ich immer diejenige bin, der man solche Aufgaben in die Hand drückt – nicht etwa, weil ich es will oder kann, sondern weil niemand sonst den Mut hat, zwischen Gläserklingen und Abschiedsworten die passende Mischung aus Haltung und Heuchelei aufzubringen, ohne dabei völlig zu zerbrechen –, stand ich also vorn, die Kehle trocken, das Herz irgendwo zwischen Stolz und Panik verrutscht.
Ich räusperte mich, ein Reflex, um die Worte in Reih und Glied zu bringen, obwohl sie in mir wie aufgescheuchte Vögel flatterten. Dann sprach ich, leise zuerst, aber mit der Entschlossenheit einer, die weiß, dass hier gerade mehr stirbt als nur ein Arbeitstag:
„Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen… danke. Für Ihre Geduld. Für Ihr Vertrauen. Und… für all das, was Sie aus uns gemacht haben – selbst dann, wenn wir es nicht bemerkt haben.“
Meine Stimme zitterte kaum merklich, wollte sich irgendwo zwischen Stimmbändern und Luft verabschieden, aber ich hielt sie fest, ließ sie nicht entkommen, denn wenn einer diesen Satz verdient hatte, dann er.
„Wir werden Sie vermissen, Herr Moreau.“
Es war nicht laut im Raum, aber auch nicht ganz still – dieses feine Raunen, das entsteht, wenn sich niemand traut zu klatschen, weil das Klatschen das Ende besiegeln würde. Gläser klangen aneinander, irgendwo ein unterdrücktes Schniefen, das sich als Husten tarnte. Und Moreau, der alte Wolf, lächelte – nicht dieses professionelle Lächeln, das man sich im Laufe der Jahre antrainiert, sondern eines, das von innen kam und dabei fast ein wenig weh tat.
„Danke, Eve. Ich glaube… ich werde euch auch vermissen.“
Und dann war er da – dieser Moment, so seltsam still, so vollkommen unspektakulär, dass er genau deshalb schwerer wog als all der Applaus, der nie kam. Kein Feuerwerk, kein dramatisches Abblenden – nur ein gemeinsames, kollektives Ausatmen, das klingt wie der Schlussakkord eines Stücks, dessen Melodie einem noch lange im Ohr bleibt.
Als ich das Gebäude verließ, klang das Klicken der Tür hinter mir wie ein Punkt am Ende eines Kapitels, das zu lang war, um es kurz zusammenzufassen. Die Sonne hing tief, warf goldene Schleier über die Dächer, als würde sie selbst nicht begreifen, dass gerade etwas zu Ende gegangen war. Alles um mich leuchtete – nur ich nicht.
Zuhause fiel die Tür ins Schloss mit dieser unspektakulären Endgültigkeit, wie sie nur der Alltag kennt, wenn er versucht, über große Gefühle hinwegzugehen. Meine Tasche rutschte mir von der Schulter, als hätte sie selbst die Schnauze voll, und während ich Schuhe und Mantel irgendwo abwarf, blieb ich einfach stehen – dort, wo die Stille wohnt, inmitten des Flurs, allein mit dem Echo der letzten Stunden.
Diese Art von Stille, die nicht beruhigt, sondern alles lauter werden lässt, was man tagsüber verdrängt hat. Gedanken, die wie Motten gegen die Decke schlagen. Bilder, die nicht verblassen wollen.
Und dann vibrierte mein Handy – nicht aufdringlich, sondern so, als hätte es gewusst, dass ich längst nicht mehr alleine sein wollte.
WhatsApp. Aurora. Natürlich.
Die einzige, die selbst durch Wände aus Schweigen findet, wenn ich mich mal wieder zu tief in mir selbst vergrabe, um noch gesehen zu werden.
Heeey! Gehen wir heute Abend in die Bar? Ich brauch dringend ein bisschen Leben!
Ich starrte auf das Display, der erste Impuls war so klar wie hart: Nein. Einfach nur nein.
Menschen, Musik, Smalltalk mit alkoholgetränktem Atem – all das war gerade so weit weg von mir wie Hoffnung.
Doch kaum gedacht, meldete sich dieser zweite Gedanke, leiser, zäher, aber hartnäckiger: Vielleicht genau deshalb.
Bin nicht in Stimmung. Der Tag war… beschissen.
Die Antwort kam, wie immer bei ihr, schneller als ich mir eine neue Ausrede basteln konnte.
Eben drum! Freitagabend! Du brauchst Glitzer, Musik, Wahnsinn. Und zwar dringend.
Ich sah sie förmlich vor mir – wie sie in ihrer Wohnung hockt, wahrscheinlich barfuß, die Füße auf dem Sofatisch, eine Chipstüte balancierend, während sie entschlossen tippt, mit funkelnden Augen und der festen Überzeugung, dass sie mich auch aus dem tiefsten emotionalen Graben zerren kann, wenn es sein muss, notfalls mit Glitzerstaub und Gewalt.
Du willst mich zwingen?
Ich will dich retten, Babe. Rotes Kleid. Lippenstift. Drama. Ich hol dich in zwei Stunden. Kein Widerspruch.
Ich hätte fluchen können – aus Trotz, aus Müdigkeit, aus diesem inneren Widerstand heraus, der sich gegen alles stemmt, was sich nach Mühe anfühlt.
Aber stattdessen lächelte ich, kaum merklich, ein kleines, zärtliches Ding, das sich irgendwo zwischen Brustbein und Erinnerungen versteckte, während ich mich fragte, ob es vielleicht genau das war, was ich brauchte – ein Abend, der mich zwingt, mich wieder zu spüren.
Zwei Stunden.
Genug Zeit, um die Asche des Tages von der Haut zu waschen und mich – wenigstens äußerlich – zu jemandem zu machen, der dem Leben noch einmal die Stirn bietet. Oder zumindest Aurora.